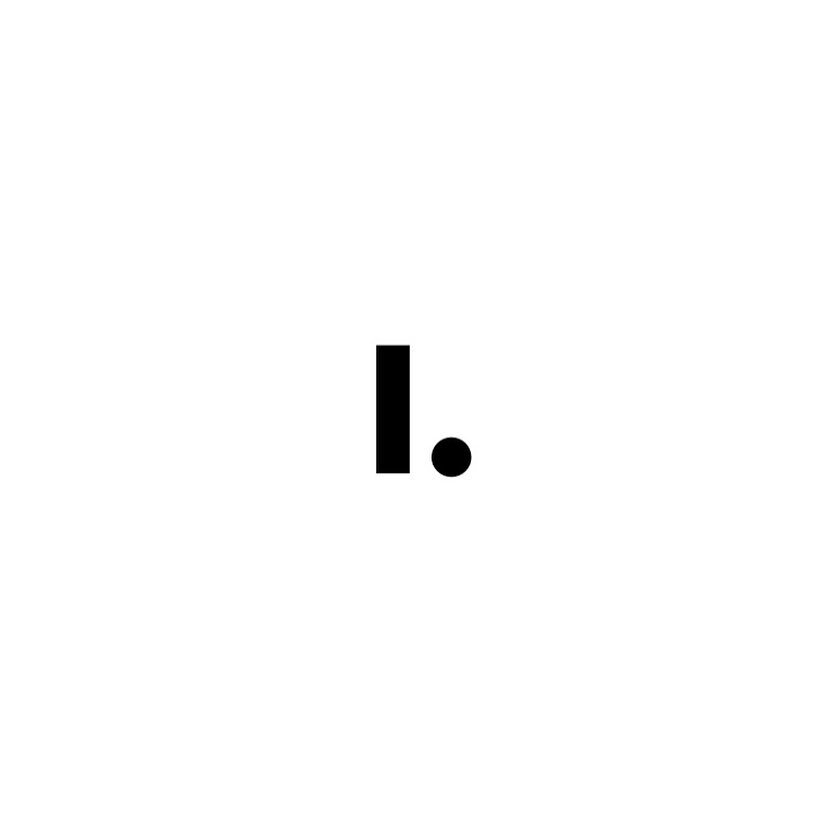“MANCHMAL BEMERKT MAN DEN KOMMUNISMUS DORT NOCH IMMER: In DEN MENSCHEN, IN IHREN LAUNEN, IN IHRER attitude”
(c) Marie Tomanova
MARIE TOMANOVA ist eine der aufregendsten jungen Künstlerinnen aus der Tschechischen Republik, ihre Wahlheimat hat sie trotzdem in New York gefunden. Ihre Ausstellung „Live for the Weather“ im Rahmen des European Month of Photography im wurde wegen der Pandemie frühzeitig geschlossen. Sie nimmt’s gelassen und lädt zum Gespräch. Gemeinsam mit dem New Yorker Kunsthistoriker und Kurator THOMAS BEACHDEL diskutiert sie über post-sowjetische Jugendkultur, Identitätspolitik und warum sie nie vorhatte, Fotografin zu werden.
Béton Bleu: Marie, deine aktuelle Show in Berlin Live for the Weather im Tschechischen Zentrum Berlin musste wegen des zweiten Lockdowns früher schließen. Jetzt hast du eine Ausstellung in New York eröffnet. Wie ist die Situation dort?
Marie Tomanova: Hier in New York ist die Situation noch total unklar. Die Covid-Zahlen steigen, aber es ist noch nicht eindeutig, welche Schritte dagegen unternommen werden. Ich persönlich finde, dass wir einen weiteren Lockdown einleiten sollten. Ich hoffe, wir tun das. Dann wären wir viel sicherer.
BB: Die soeben beendete Ausstellung „Live for the Weather“ ist gewissermaßen ein Höhepunkt deiner letzten zehn Jahre als Fotografin und Kuratorin. Der Titel kommt von einer Arbeit, die 2017 in der Ausstellung „Baby I Like It Raw: Post-Eastern Bloc Photography & Video“ zu sehen war. Wie dominant ist das Thema der postsowjetischen jungen Generation in deiner Arbeit?
Marie: Das was man im Englischen mit „Displacement“ übersetzt, also die Verlagerung eines Wohnortes woanders hin, als auch dessen Auswirkungen auf Identität sind definitiv ein großer Teil meiner Arbeit. Thomas und ich wurden 2017 vom Tschechischen Zentrum New York angesprochen, um eine Ausstellung zu konzipieren, die die junge Generation in den Blick nimmt, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs aufgewachsen ist. Es war faszinierend zu sehen, wie diese jungen Menschen ihre Umwelt sehen. Wir haben dabei mit so vielen talentierten Fotografen und Filmemachern aus dem gesamten ehemaligen Ostblock und der Sowjetunion zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Slava Mogutin, Masha Demianova, Sasha Kurmaz, Gorsad, Daniel King, Martynka Wawrzyniak oder George Nebieridze, um nur einige zu nennen.
(c) Masha Demianova, Baby I Like It Raw: Post-Eastern Bloc Photography & Video
BB: Der kuratorische Text zur Ausstellung klingt recht kritisch. Ihr schreibt: „Der Westen ist dick, fett, fett und gefräßig geworden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er alles verschlungen, nur um ein globales Netz von Konsumwünschen zu spinnen und Identitäten durch Materialismus und Medien zu formen.“
Thomas: Tatsächlich haben die ausgewählten Fotografien eine besondere Energie. Man muss aber auch sagen: Jene Kinder, die kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Russland, Polen oder der Tschechischen Republik aufwuchsen, verteidigen ihre Identität gegen eine Geschichte des Konsums, die sie nie hatten, aber sie jetzt nun doch haben. Jeder teilnehmende Künstler und jede teilnehmende Künstlerin lud zu einer anderen Perspektive auf das Leben ein, das von totalitärer Herrschaft oder auch deren Abwesenheit beeinflusst ist.
(c) Marie Tomanova
(c) Daniel King, Baby I Like It Raw: Post-Eastern Bloc Photography & Video
BB: Die Ausstellung spielt auch mit dem Klischee des "rohen slawischen Volkes" aus dem Osten. War das eine bewusste Entscheidung?
Thomas: Wir wollten nie bewusst ein Stereotyp oder Klischee des "rohen slawischen Volkes" beschwören, der Titel ist von dem Rapper ODB-Song (Ol' Dirty Bastard) entnommen. Die Fotografen Slava und Boris Mikhailov waren die Prüfinstanzen der Bildgestaltung für die Ausstellungskuration, sie wurden anscheinend stark von der jungen Generation angezogen, die sich roh und verspielt positionieren möchte. Die Bilder sind auch roh und direkt. Für mich als Kurator ist das ziemlich schwierig: Wie benennt man diesen Ort, der einmal Ost-Block war und nun in viele verschiedene Länder und Kulturen auseinandergebrochen ist – ohne in Klischees zu verfallen? Der Ostblock war ja bis zum Anfang der 1990er Jahre nicht nur geographisch isoliert, sondern auch kulturell, politisch, sozial, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Die jüngere Fotografengeneration spielt mit diesem Narrativ. Die Generation von Marie ist wahrscheinlich die erste, die tatsächlich außerhalb des Ostblocks reisen konnte. Diese "Öffnung" ist noch nicht einmal eine ganze Generation alt.
Marie: Als ich 26 Jahre alt war, verließ ich die Tschechische Republik und kam erst acht Jahre später zurück. Ich weiß noch wie ich mir dachte: Interessant, diese kommunistische Zeit spürt man hier tatsächlich noch. Sie ist immer noch da: In den Menschen, in der Stimmung, in der Einstellung. Ich war sehr überrascht.
(c) Marie tomanova
BB: Marie, du wurdest noch in der Tschechoslowakei geboren, aus der dann 1993 die Tschechische Republik hervorging. Hast du den Eindruck, dass deine Kindheit davon geprägt wurde?
Marie: Als der eiserne Vorhang fiel, war ich fast fünf Jahre alt. Ich erinnere mich also nicht an einen unmittelbaren Unterschied, dafür war ich noch zu klein. Außerdem liegt die Kleinstadt, in der ich aufwuchs, Mikulov, nur zehn Minuten von der österreichischen Grenze entfernt. In einer Stunde war man in Wien, nach Prag hingegen braucht man fast drei Stunden. Deswegen war ich mit meiner Mutter oft in Wien, um Ausstellungen und Museen zu besuchen. In diesem Sinne war meine Kindheit also recht offen. Gleichzeitig lebten wir aber trotzdem in einer Blase: Es gab kein Instagram, Netflix oder Youtube. In meiner Studienzeit gab es keine Austauschprogramme, niemand kannte Erasmus. Die US-Kultur war auch bei weitem nicht so dominant wie heute mit den Smartphones und digitalen Angeboten. Als ich in die USA kam, verstand ich fast gar keine kulturelle Referenz, ich kannte ja nur Sex & The City aus dem Fernsehen. Heute wäre das anders.
BB: Diese frühen 2000er Jahre, deine Studentenzeit, hast du obsessiv abfotografiert. Wie sind diese Bilder in der Ausstellung "Live for the Weather" im Tschechischen Zentrum Berlin gelandet?
Marie: Ich bekam 2005 ein Telefon, mit dem man Fotos machen konnte, das war etwas völlig Neues für uns. Niemand anderer in meinem Freundeskreis hatte so eine erstaunliche Technologie! Also begann ich, alles um mich herum aus Spaß zu fotografieren. Diese Bilder wurden zu einem visuellen Archiv von Liebe, Trennungen, Euphorie, Trauer, im Grunde von allem, was uns damals passierte. Ich hatte schon immer einen Drang, meine unmittelbare Umgebung zu dokumentieren.
Thomas: Als ich dann die Bilder sah, dachte ich: Sie passen perfekt zum englischen Spruch „Live for the weather“. Das bedeutet so viel wie: Lebe für den Augenblick, sei jung, sei glücklich, sei traurig. Wenn es regnet, zieh‘ einen Mantel an, wenn die Sonne scheint, geh mit T-Shirt raus. Ich glaube, dieses Gefühl bedeutet Jungsein: Alles ist in diesem Moment.
(c) Marie Tomanova
BB: Marie, wie bist du zur Fotografie gekommen?
Marie: Ich wollte Künstlerin werden, also studierte ich Malerei. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass Fotografie mein Medium werden würde. Ich habe sogar einen Master-Abschluss in Malerei. Aber meine Zeit an der Kunstschule habe ich sehr negativ in Erinnerung; als ich abschloss, schwor ich mir, nie wieder zu malen.
BB: Weshalb?
Marie: Mein Professor an der Fakultät für Bildende Künste in Brno war weder ermutigend noch habe ich viel von ihm gelernt. Während der Studienzeit drehte sich außerdem alles um „bohemian life“; wir hingen nur im Atelier herum und malten. Einige Jungs schauten sich dort sogar Pornos an. Die Atmosphäre war allgemein sehr patriarchalisch und sexistisch.
Außerdem stellte uns die Kunstschule weder Kuratoren vor, noch lehrte sie uns, wie man Galerien kontaktiert oder sich um Künstlerstipendium bewirbt. So etwas sollten aber alle Kunststudenten können. Sie sollten wissen, wie man einen guten Lebenslauf schreibt, wie man sein Künstlerstatement verfasst oder dass die Teilnahme an Ausschreibungen und Open Calls bei Ausstellungen entscheidend ist! Bei mir gab es damals keine praktische Seite der Ausbildung. Als ich 26 war und meinen Abschluss in der Tasche hatte, dachte ich mir nur: Fuck, und jetzt?
(c) Marie tomanova
BB: Was würdest du anderen Student*innen in derselben Situation raten?
Marie: Wenn du unglücklich bist, aber weißt, was du möchtest: Ändere deinen Fokus und mach‘ die Dinge, die du wirklich machen möchtest. Wenn du aber nicht weißt, was du tun sollst: Verschaffe dir Zeit, um es herauszufinden.
(c) MARIE TOMANOVA
BB: Was hast du gemacht?
Marie: Ich beschloss als Au Pair nach North Carolina in den USA zu gehen. Ich habe mir Zeit freigekauft, um herauszufinden, was ich als nächstes tun soll. Wenn man aus einer Kleinstadt wie Mikulov kommt, die etwa 8.000 Einwohner hat, wo jeder jeden kennt, dann ist die eigene Identität eingefroren. Auch in deinem eigenen Kopf verortest du dich in Schubladen. In den USA wurde mir klar: Das muss nicht sein, ich kann sein, wer ich bin. Es war ein Neuanfang. Diese Art der Freiheit ist extrem aufregend und beängstigend zugleich.
(C) Marie tomanova
BB: Wie bist du nach New York gekommen?
Marie: Au Pair zu sein war eine tatsächlich interessante Erfahrung. Die Kinder waren die meiste Zeit in der Schule, ich hatte also viel Zeit, die neue Kultur zu erkunden. In dieser Zeit habe ich viel geschrieben, alles festgehalten. Alles war neu für mich, ich war total fasziniert. Und alles war so riesig! Die Straßen, der Kaffee, die Autobahn – everything is big, big, big.
Nach meinem ersten Jahr in North Carolina zog ich zu einer anderen Familie in den Norden, in den Staat New York. Ich hatte an den Wochenenden frei, also fuhr ich nach New York City und besuchte das Metropolitan Museum. Es war der einzige Ort, wo man nur mit einem Dollar Eintrittsgeld hineinkam. An meinem zweiten Wochenende im Museum traf ich Thomas. Er machte gerade eine Führung und ich schloss mich einfach der Gruppe an. Ich war so fasziniert von allem, was er sagte. Am Ende seines Vortrags fragte ich ihn einfach um seine Telefonnummer. Danach sahen wir uns jedes Wochenende Ausstellungen an.
BB: Also hast du da schon fotografiert?
Marie: Ich habe Fotografie nie als ein Medium betrachtet, das ich ernsthaft ausüben könnte, ich hatte es ja nicht studiert. In der Tschechischen Republik ist die Kulturszene noch immer sehr akademisch geprägt. Wenn man nicht etwas Künstlerisches studiert hat, kann man unmöglich gut darin sein. Das hat mich lange gehemmt. Dann hatte ich aber doch eine Offenbarung, nämlich, als ich Francesca Woodmans Ausstellung im Guggenheim-Museum zum ersten Mal sah: Ich war überwältigt und sprachlos. Zum ersten Mal in meinem Leben dachte ich: Warum habe ich nie fotografiert? Also beschloss ich an diesem Tag mich für Abendkurse an der School of Visual Arts in Manhattan anzumelden, und begann tatsächlich zu fotografieren. Ich war da schon 27, 28 Jahre alt. Langsam bekam ich auch immer mehr positives Feedback. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Fotografin werden würde. Aber es ist tatsächlich das, was mich am Allermeisten erfüllt.
(c) MARIE TOMANOVA
BB: Heute, neun Jahre später, bist du für deine einzigartigen fotografischen Stil bekannt. Wirst du in den USA eher als tschechische Künstlerin oder eher als europäische Künstlerin wahrgenommen?
Marie: In den USA kennen noch immer viele Menschen die „Tschechoslowakei“ besser als „Tschechische Republik“. In den Medien werde ich immer als tschechische Künstlerin vorgestellt, die Nationalität kommt immer als erstes zur Sprache. Als „europäische Künstlerin“ werde ich fast nie bezeichnet.
Thomas: Als Kunsthistoriker, oder einfach als Mensch, bin ich immer noch ein wenig überrascht, wenn jemand sagt: "Das ist ein französischer Künstler / ein schwarzer Künstler / eine weibliche Künstlerin / ein Transkünstler" und sie damit automatisch in einer Kategorie verortet, die auf dem Aspekt der Nationalität oder sexuellen Identität basiert. Das passiert auch in der feministischen Kunstszene sehr oft. Als Marie ihre Selbstporträtserie machte, wurde sie plötzlich zur "feministischen Künstlerin" ausgerufen, nur weil sie eine Frau ist. Aber sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit doch gar nicht vorwiegend mit Feminismus, es geht eher darum Menschen allgemein und Frauen im Besonderen zu ermächtigen.
Marie: Ich finde diese Zuschreibungen interessant, es lohnt sich, das näher zu reflektieren. Ja, ich bin Tschechin, aber in meiner Arbeit geht es nicht vorwiegend um Tschechien. Ich bin eine eingewanderte, weibliche Künstlerin in den USA und dieser Umstand prägt meine Arbeit definitiv. Aber eben nicht nur. Die Gefahr bei so einer identitätspolitischen Etikettierung ist, dass sie das Potenzial eines Werkes massiv einschränken.
(c) Marie tomanova
BB: Du bist erst nach acht Jahren in den USA nach Europa für einen Besuch zurückgekommen. Wie hast du danach die tschechische Kunstszene wahrgenommen?
Marie: Als ich 2018 nach Prag zurückkehrte, war ich doch von einigen Dingen in der Kunstszene ziemlich überrascht. Der größte Unterschied zwischen der tschechischen und New Yorker Kunstszene besteht darin, wie man als Künstler*in entlohnt wird. In der Tschechischen Republik gibt es staatliche geförderte Strukturen der Kunst- und Kulturszene. Sie werden mit Stipendien, Netzwerken, Programmen und Finanzierungen durch die Europäische Union unterstützt.
BB: Und in New York?
Marie: In New York geht es mehr um Publicity, um die Reichweite. Man wird "bezahlt", indem man in einer Zeitschrift rezensiert wird oder in eine Ausstellung oder Sammlung aufgenommen wird – die Währung ist also nicht immer bar. In der Tschechischen Republik bekommt man aber Reichweite und ein Einkommen. Natürlich ist diese Art der Reichweite nicht so groß wie in New York, deshalb kann sich ja New York auch leisten, auf einer solchen Welle der subtilen Ausbeutung zu surfen. Aber viele Künstler*innen aus der Tschechischen Republik sind zu Recht schockiert, dass Künstler*innen anderswo nicht einmal das Geld für ihre Ausgaben erstattet bekommen. In der tschechischen Kunstszene gibt es vehementen Widerstand gegen die New Yorker Art, was ich voll und ganz unterstütze.
(C) MARIE TOMANOVA
BB: Wie geht es der tschechischen Kunstszene während der Covid-19-Pandemie?
Marie: Da wir im Moment nicht in der Tschechischen Republik sind, ist das schwer zu sagen. Aber vor Covid-19 ging es der Szene gut, auch wenn auch sie sich verändert. Wie gesagt, es gibt von vielen Seiten Druck, dass Künstler*innen für ihre Arbeit fair belohnt werden, dahinter stehen viele Initiativen, Verbände und Gewerkschaften. Der Kehrseite davon ist nur, dass die tschechischen Künstler*innen Mühe haben, außerhalb der Tschechischen Republik bekannt zu werden. Ich denke, die Szene funktioniert innerhalb recht gut, aber da die Tschechische Republik nun einmal ein sehr kleines Land ist, ist es schwierig, auch außerhalb bekannt zu werden und Anerkennung zu bekommen. Von vielen in Tschechien sehr berühmten Künstler*innen hat man in New York zum Beispiel noch nie gehört. Es ist aber wichtig, den Künstler*innen außerhalb ihres eigenen Landes Anerkennung zu verschaffen.
BB: Würde das durch mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit gehen?
Marie: Auf jeden Fall. Unsere Welt ist global.
Thomas: Mehr kulturelle Zusammenarbeit ist immer notwendig - mehr Unterstützung, mehr Identifikation mit anderen. Den Kunst- und den Geisteswissenschaften als Mittel zur Verbindung mit dem, was das Menschsein bedeutet, sollte immer mehr Wert beigemessen werden.
(C) MARIE TOMANOVA
BB: Thank you for your time.
Interview: Ana-Marija Cvitic
More about Marie Tomanova’s work:
Instagram: @marietomanova
Contact: www.marietomanova.com
(C) 27/11/2020
FIND more curated content on instagram: @bétonbleumagazine