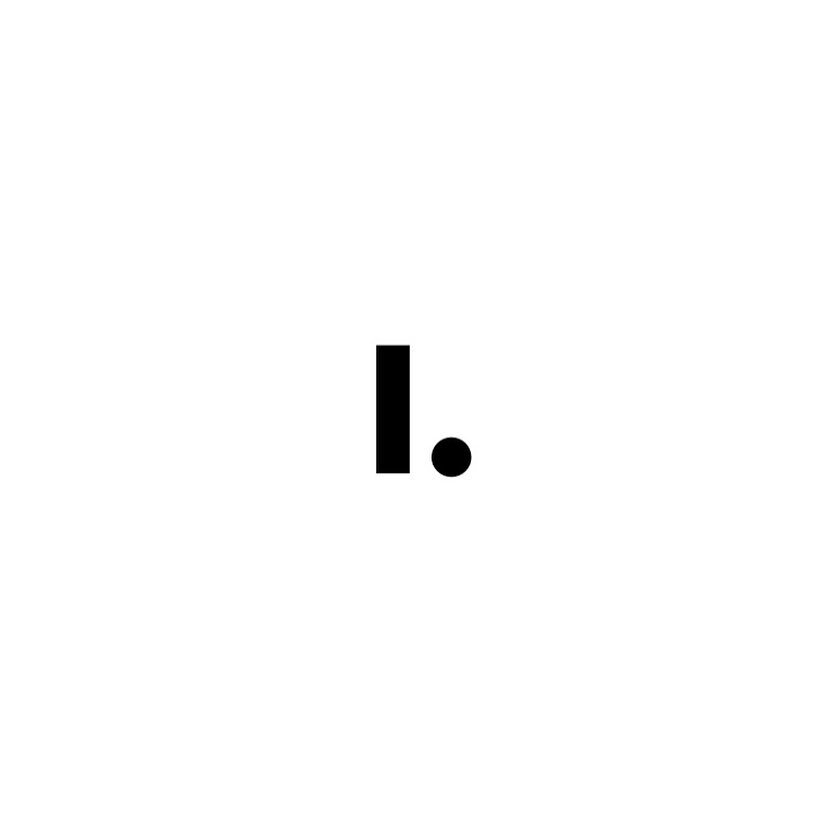“Revolutionär wird es, wenn man das ökonomische und kulturelle system verknüpft”- MILO RAU
Ein Ausschnitt aus der Inszenierung von “Lenin” an der Schaubühne in Berlin © Thomas Aurin
Seit dem Beginn der Pandemie hat sich nicht nur der politische Raum massiv verändert. Auch Kulturschaffende mussten sich auf eine neue Realität einlassen. Béton Bleu sprach mit dem Theaterregisseur, Filmemacher und Aktivisten Milo Rau über die Rolle von Kunst als Mittel des Widerstands und wie sie sich nach der Pandemie verändern wird.
Milo Rau © Bea Borgers
Béton Bleu: Lieber Herr Rau, fehlt Ihnen die Bühne? Oder hat Sie die Pandemie inspiriert, Ihre Arbeit auch jenseits der Bühne umzusetzen?
Milo Rau: Ich glaube, dass Krisen einerseits natürlich immer das System stärken, aber andererseits auch neue Wege offenlegen. Gerade im Theater gibt es sehr viele Dinge, die nur live und zusammen gemacht werden können. Und eine Produktionsgesellschaft wie das IIPM [International Institute of Political Murder] gerät schnell in Schwierigkeiten, wenn nicht mehr getourt werden kann. In Gent, wo ich ein staatliches Haus leite, habe ich versucht, den Freien ihre Gagen auszuzahlen, auch wenn sie nicht spielen und zudem andere Termine zu finden, damit der Ausfall so gering wie möglich ist. Zugleich ist es vielleicht ganz gut, dass dieser Drang, in die Säle des 19. Jahrhunderts zurückzukehren, seit Monaten auf Eis liegt. Dass man gezwungen war, andere Wege zu finden.
BB: Haben Sie ein Beispiel für diese anderen Wege?
MR: Zum ersten Mal konnte ich meine Werke wie “Lenin” oder das “Kongo Tribunal” einem internationalen Publikum zeigen, hatten die, die es angeht, Zugang: die Russen, die Kongolesen. Dazu wären die Verleiher vorher nie bereit gewesen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Öffnung bestehen bleibt. Gleichzeitig haben wir angefangen, unsere Aufführungen draußen zu zeigen und über Möglichkeiten nachzudenken, grundsätzlich anders zu programmieren.
Mit unserem "All Greeks" Festival werden wir einen Monat lang alle griechischen Tragödien unter freiem Himmel spielen, 32 Stücke, immer von 7 bis 9 Uhr oder 8 bis 10 Uhr morgens. Warum soll man immer abends bei künstlichem Licht spielen? Warum immer zuerst die Arbeit, dann erst die Kunst? Warum nicht alles einfach mal umdrehen? Das sind Dinge, die naheliegend sind, aber auf die man nicht kommt, wenn man nicht dazu gezwungen ist. Ein bisschen fürchte ich aber, dass das Theater und die Debattenkultur nach der Krise konservativer sein wird als davor, weil die Menschen in Krisen immer einen Drang zur Hyper-Normalität spüren.
BB: In der Pandemie hat die Kunst ihre oft beobachtende Rolle verlassen und war selbst sehr direkt betroffen. In vielen Ländern, auch in Deutschland, stehen die Kulturbetriebe still. Wir erleben, wie sich in Frankreich die Arbeiter der Kulturindustrie wehren und größere Unterstützung vom Staat einfordern. Kultur ist ein sehr direkter Teil der Protestkultur rund um die Pandemie. Wie nehmen Sie diese Veränderung wahr?
MR: Das Theater ist eine Live-Art, es braucht die öffentliche Aufführung, das war schon immer sein Wesen. Das ist beim Film anders. Zwar sind die Kinos geschlossen, aber man kann ja alles streamen – für das “Neue Evangelium” haben wir zum Beispiel selbst eine Plattform gebaut, mit 150 geschlossenen Kinos zusammen. Für das Theater ist der öffentliche Raum und die physische Teilhabe zentral. Gleichzeitig finde ich diese Theaterbesetzungen fast ein bisschen kontraproduktiv: Warum will man denn unbedingt in diese Theater zurückkehren? Warum halten wir an diesen Strukturen fest? Warum versuchen wir nicht die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, so gut wie möglich zu nutzen und auszubauen.
Man sollte die Institutionen nicht besetzen, um dort zu spielen, sondern um sie zu zwingen, ihre Mittel und Möglichkeiten zu demokratisieren. Das ist ein bisschen wie mit Parteien, da hat man auch irgendwann gemerkt, dass sie gar nicht so effektiv sind wie erhofft und es außerparlamentarische Bewegungen braucht, um wirklich etwas zu verändern. Deshalb muss die Kunst die Politik und vor allem das ökonomische System hacken, man muss parallel Wege zu den normalen Wegen des Kapitals finden. Neue Distributions- und neue Produktionsweisen. Und da wird der Zwang, neue Wege zu beschreiten, plötzlich sehr befreiend und zwingt zu postkapitalistischen Alternativen.
Eine Szene aus Milo Raus neuem Film "Das neue evangelium" © Fruitmarket:Langfilm
BB: Was meinen Sie damit konkret?
MR: Zu Anfang der Pandemie habe ich für die Kammerspiele ein Plakat entworfen, auf dem es hieß: Wenn du nicht relevant bist fürs System, dann ist das System vielleicht nicht relevant für dich. Dieser Wunsch, innerhalb des kapitalistischen Systems systemrelevant zu sein, als Teil der Unterhaltungsindustrie, ist der falsche Ansatz. Es ist besser, wenn man Parallel-Ökonomien schafft. Wie gesagt: Mit meinem neuen Film "Das neue Evangelium" haben wir auch überlegt, ob wir zu Netflix oder Amazon gehen sollen. Letztlich haben wir uns aber entschieden, unsere eigene Plattform aufzubauen - und hatten damit die besten Einspielergebnisse, die wir je hatten, solidarisch mit den geschlossenen Kinos, die die Erlöse erhalten. Man muss nicht immer von neuem die gleichen Geschichten in den gleichen Räumen mit den gleichen Darstellern erzählen.
BB: Im Manifest ihres Schauspielhauses NT Gent heißt es „It's not just about portraying the world anymore. It's about changing it.“ Sie haben sich in Ihrer Arbeit mit dem Genozid in Ruanda und der Vertreibung der Ureinwohner Brasiliens beschäftigt. Ihr letzter Film „Das neue Evangelium“ wurde in Italien gedreht, die Darsteller waren selbst Geflüchtete. Wie bringt man die Menschen dazu, Kunst nicht nur zu konsumieren, sondern sie zum Anlass zu nehmen, die Welt mitzugestalten?
MR: Zufällig las ich gerade eine Beuys-Biographie, und Beuys hat das vorgemacht, wenn auch auf manchmal altmodische, deutsche Weise: Es geht darum, Kunst und Kapital revolutionär zu verbinden. Man muss den Kapitalismus, die Ökonomie "hacken". Kunst und Engagement können nicht unabhängig vom Kapital funktionieren, dann sind sie machtlos. Es geht nicht nur um politische Reichweite oder Deutungsmacht. Revolutionär wird es, wenn man es schafft, das ökonomische und kulturelle System zu verknüpften.
BB: Wie sieht das aus?
MR: Als wir “Das Neue Evangelium” in den süditalienischen Flüchtlingslagern drehten, sagten wir: jeder, der hier mitspielt, hat nachher Papiere, ist Bürger. Und damit das nachhaltig ist, begannen wir, die Distributionswege des Films an die von Gütern zu knüpfen, in diesem Fall von Tomaten. Und dann geht es auf einmal nicht mehr um einen Film und um Bilderpolitik, es geht auch nicht mehr nur um faire Produktionsbedingungen, sondern um ein ganzes alternatives System. Denn wenn man die Tomaten, die man fair produziert, nicht zum Endverbraucher bringt, dann hat man ein Problem. Wenn Hashtags und Kampagnen am Ende kein Geld einbringen für eine bestimmte Sache und diese Sache nicht nachhaltig ist, dann ist niemandem geholfen. Man muss Veränderung innerhalb des Systems herbeiführen, indem man die Distributionswege besetzt. Es geht nicht mehr darum, nur Bilder zu besetzen, sondern auch Land, Verteilungswege, politische Entscheidungspositionen.
“The Interrogation” mit dem schriftsteller edouard louis © michiel devijver
BB: Wie hilft die Kunst dabei?
MR: Indem ein jedes Projekt eben als Mikroökonomie verstanden wird. Da gibt es die gewaltigen kollektiven Anstrengungen wie das neue Distributionssystem für “Das Neue Evangelium” oder dass die im Rahmen des Projekts promoteten NoCap-Tomaten in Supermärkte in ganz Europa kommen. Aber auch kleine Projekte sind wichtig: Spendenkampagnen, um Land zu kaufen für die Produktion von alternativen Gütern. Jeder noch so kleine Akt zählt: Ich knüpfe alle Interviews – zum Beispiel auch dieses – an eine Spende für eine Kampagne, die sich für die Integration von Geflüchteten in Süditalien einsetzt. So können wir pro Tag vielleicht einen, pro Woche zehn, pro Jahr 1000 Menschen aus Abhängigkeit und Sklaverei holen, und das alles durch die Mittel der Kunst, weil das die einzigen Mittel sind, die ich kenne und einsetzen kann.
Natürlich ist es auch wichtig, einen schwarzen oder weiblichen oder muslimischen Jesus oder Apostel zu besetzen, wie wir das gemacht haben in dem Film. Aber man muss sich genauso fragen: Wer kriegt das Geld, wenn die Leute ins Kino gehen? Was wird aus diesen Leuten danach? Wie ändern wir ihre Lebensumstände grundsätzlich? Man muss die Art und Weise, wie Film, Literatur, wie Gespräch, wie all das produziert wird, selbst verändern. Wir müssen grundsätzlich und strukturell solidarisch denken und handeln. Es geht nicht mehr darum, perfekte Bubbles zu schaffen, das ideale Kunst-Festival mit der idealen Programmbroschüre. Es geht darum, die Welt zu verändern für genau die Menschen, die über Jahrhunderte nur die Objekte dieser künstlerischen Diskurse waren. Das meine ich, wenn ich sage, Kultur und Kapital müssen verknüpft werden.
BB: Ist es nicht auch wichtig, dass Kunst eine gewisse Distanz bewahrt, um Entwicklungen beobachten zu können, oder ist eine Einmischung notwendig, um relevant zu sein?
MR: Distanz ist in einer Welt, in der alles bis ins Kleinste verknüpft ist, in einer Ökonomie, in der es kein Außerhalb gibt, ein Statement an sich. Das sogenannte “Außerhalb”, die “Distanz” ist ein anderes Wort für Privilegien. Mit anderen Worten: Jede menschliche Handlung ist politisch, und ich glaube deshalb nicht, dass es einen unpolitischen Raum gibt. Wenn man 1944 in Deutschland ein Stück von Tschechow oder eine Symphonie von Beethoven aufführt, dann ist man unpolitisch in dem Sinn, dass man einen reinen Kunstraum innerhalb des millionenfachen Mordens schafft und damit das faschistische Regime unterstützt. Wir erschaffen unser wirtschaftliches System jeden Tag durch die Handlungen von uns allen, halten es am Laufen, aber verändern es eben auch.
Daher ist es ein großer Irrtum, dass man von heute auf morgen die Weltrevolution anstreben muss. Es geht vielmehr um die kleinen Akte. Frei nach Brecht: Ich versuche nicht die Fabrik von außen anzugucken, sondern ich bin immersiv, ich gehe in die Fabrik hinein, ich stelle mich an die Werkbank, ich versuche, eine lokale, reale Solidarität herzustellen und die dann systemisch nach und nach zu globalisieren. Der distanzierte Blick, die heute ja sehr verbreitete Angst unter Privilegierten, Fehler zu machen, unterstützt im Endeffekt den Status Quo.
Milo Rau während der Arbeit an “Das neue evangelium” © NTGent
BB: Jenseits der Pandemie erleben wir seit einiger Zeit in einzelnen Ländern Europas, etwa Polen oder Ungarn, eine massive Einschränkung von grundlegenden Rechten wie der Pressefreiheit, von Versammlungs- und Menschenrechten, eine gezielte Diskriminierung von Minderheiten und Zuwanderern. Welche Rolle kann Kunst in der Widerstandsbewegung in Europa spielen?
MR: Was mir immer sehr geholfen hat, ist die Solidarität, die zeigt, dass man nicht alleine ist. Staatliche Macht funktioniert immer mit Essentialismen, Menschen werden rassisiert, nach ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer Religion essentialisiert, vereinzelt. Damit es so wirkt, als treffe sie die Aussonderung eben genau wegen dieser Qualität, ihrer Hautfarbe etwa – und sie den Fehler bei sich selbst suchen. Der Holocaust und Vorgänge der Entsolidarisierung überhaupt in der Gesellschaft haben funktioniert, weil sich die Menschen nicht mehr betroffen fühlten von dem, was anderen passierte. Hass-Kampagnen funktionieren immer über Stigmatisierung, und am Ende denkt jeder, die Unterdrückten, Ausgesonderten seien essentiell selbst schuld an dem, was ihnen widerfährt – oder stehen immerhin betreten und schweigend dabei, wenn jemand geframed wird.
BB: Welche Rolle übernimmt Kunst, wenn es darum geht, diese Taktik zu verhindern?
MR: Kunst kann durch Bilderpolitik eine Solidarisierung und Identifikation schaffen. Dass man mit Hilfe von Generalbegriffen, über Bilder und Geschichten, zum Beispiel mit der Jesus-Geschichte, plötzlich merkt, das ist gesamtmenschliche Geschichte, das ist eine Geschichte der Unterdrückten – und sie findet heute statt, sie betrifft uns alle. Und man eben nicht denkt, was in Polen stattfindet, findet in Polen statt, was in den Vierziger Jahren stattfand, hat nur dort stattgefunden. Zeit und Raum gibt es als künstlerische Topografie nicht. Kunst kann gegengeschichtlich sein, Kunst kann mit den Toten in Kontakt treten, Kunst kann über das noch nicht Geschehene sprechen. Kunst kann Utopie sein, und Kunst kann gleichzeitig diese Utopie in der absoluten, emotionalen und kollektiven Realität eines Theaterprojekts und eines Filmabends stattfinden lassen. Kunst kann direkt affizieren und ist zugleich absolut fiktional. Wirklichkeit und Utopie, Praxis und Hoffnung zusammenzubringen – das ist Kunst.
BB: Sehen Sie eine Gefahr darin, dass es in einer Zeit wie jetzt, in der Kunst nicht in derselben Weise stattfindet, wo Bühnen geschlossen sind, in der die Menschen nicht auf die Straße gehen und nicht zusammenkommen können, leichter für Diktatoren und Autokraten wird, Systeme zu beeinflussen?
MR: Ja, in Krisen werden Rechte zurückgedreht, Krisen sind regressiv. Das verwirrende ist ja immer: Das Konservativste, das Zerstörerischste wird gegen die erlebte Zerstörung in Anschlag gebracht. Krisen und Krieg entmenschlichen den Umgang der Menschen untereinander. Das Problem heute ist vor allem, dass Kunst aus dem Lebenszusammenhang herausgelöst wird. Eine Theaterprobe, ein Stück anzuschauen, danach zusammen zu sein und darüber reden, das ist der eigentliche Vorgang, der mich interessiert. Es ist keine Abfertigung, zu der man mit einer Maske im Gesicht hingeht, die Sache konsumiert und wieder geht und sich ja nicht zu nahekommt.
Leben und Kunst zu trennen, ist eine unter vielen kapitalistischen Strategien der Entfremdung, die seit Jahrhunderten ablaufen und damit eigentlich nichts Besonderes – aber zurzeit sehen wir das gewissermaßen in Reinform: du kaufst dir ein Ticket, betrittst einen Chat-Raum und schaust auf andere Menschen, die irgendwo sonst live sind. Wie gesagt, das ist Kapitalismus in Reinform: Kunst wird zum Konsumgut, der Körper des anderen zum Objekt einer distanzierten Betrachtung. Dabei besteht Theater gerade darin, Körper in einen lebendigen, utopischen Praxiszusammenhang zu bringen. Das ist es, was seit 13 Monaten ganz brutal wegfällt. Dabei wächst und verändert man sich nur in Relation zu und gemeinsam mit anderen.
“Das Kongo Tribunal”, 2017 © IIPM, Freuitmarket, Langfilm
BB: Erleben Sie zurzeit eine größere Solidarität über Ländergrenzen hinweg?
MR: Ja und nein. Vor allem am Anfang gab es eine starke Tendenz zur Nationalisierung, und auch jetzt gibt es noch immer eine extreme föderale Fragmentierung, selbst innerhalb Deutschlands. Da hat eine Entsolidarisierung stattgefunden, nicht als bewusste politische Entscheidung, sondern einfach, weil die langfristigen solidarischen Strukturen – etwa das Arbeitslosengeld, die Krankenkassen – national sind. Und das ist ein allgemeines Problem, das sich ja auch im Kampf gegen den Klimawandel oder in der Warenindustrie zeigt: die langfristigen Kosten werden in den Globalen Süden ausgelagert, wo es diese Systeme nicht gibt. Die Leute, die am Anfang der Produktionskette stehen, können nicht plötzlich ein paar Monate keine Baumwolle oder kein Coltan produzieren, nur weil die T-Shirts oder die Computer nicht gebraucht werden. Sie haben keine verarbeitende Industrie und können mit diesen Rohstoffen nichts anfangen, wenn sie ihnen nicht abgenommen werden.
Auf der positiven Seite haben wir aber auch gemerkt, wie schlagkräftig zumindest am Anfang diese Nationalstaaten waren, welch extreme Forderungen ein Nationalstaat an seine Bürger und auch an seine Wirtschaft stellen kann. Es klingt etwas seltsam, aber diese rationale, in größeren Zusammenhängen denkende, auch solidarische Disziplin der Bürger beruhigt mich im Zeitalter des Klimawandels, wo nur Kollektiv-Aktionen etwas bringen.
BB: Und sehen Sie das auch in der Kunst und Kultur?
MR: Das Problem in der Kunst ist, dass sich sehr viele feinsinnige, intelligente, aber auch narzisstische Menschen zusammenfinden, mit einem starken Hang zum Minimaldissens. Ich bin hier im Einzelinterview, aber organisiere ich ein Panel von zehn Künstlern und lasse sie über genau die Themen diskutieren, die wir hier gerade angesprochen haben: globale Solidarität, die Veränderung der Welt. Da ist es nach zehn Minuten vorbei mit der Solidarität, dem Zuhören, nach zehn Minuten beginnt der Essentialismus: wer spricht, warum, mit welchen Worten. Da gibt es einen Drang, Recht zu behalten und sich an bestimmten Formulierungen, die ok oder nicht ok sind, aufzuhalten. Jeder, der schon mal einen offenen Brief gemeinsam mit fünf NGOs geschrieben hat, weiß, wie lange es dauert, bis man sich auf die Details geeinigt hat.
Das ist das Problem des Kulturbetriebs, dass wir uns mit Universalfragen beschäftigen - der Erinnerung, der Tradition und der möglichen Utopien - aber gleichzeitig, wie jede Versammlung von Menschen, ein Club von Kleingeistern und Narzissten sind. Das ist das, woran wir kranken. Wir haben nicht die "Kühlheit" von Wissenschaftlern und Forschern, die ein Bakterium als Fakt akzeptieren und nicht herumdeuten oder bestimmen wollen. In der Kunst ist Solidarität, die nicht negativ besetzt ist, wo man sich zum Beispiel nicht mit einem offenen Brief gegen etwas wendet, sondern die positiv besetzt ist, wo man gemeinsam und leidenschaftlich nach Lösungen sucht, schwer herzustellen. Darunter leide ich sehr, unter dieser oft leider völlig destruktiven Aggressivität. Und deshalb ist solidarisches Arbeiten eigentlich das Einzige, was mich noch interessiert.
BB: Und da hat die Kunstszene auch im vergangenen Jahr nichts dazugelernt?
MR: Das würde ich so nicht sagen, es gab ja Initiativen, es gab auch durchaus Druck auf den Staat. Darin sind die Künstler sehr gut, weil sie gehört werden, weil sie Profis in der Nutzung der öffentlichen Meinung und der Medien sind. Ich glaube, rein strukturell gesprochen gibt es in der Kunst schon Solidarität. Es gibt grundsätzlich eine Bereitschaft, sich stärker um bestimmte soziale Aspekte in der Nische zu kümmern als das in anderen Berufen der Fall ist, in denen man nicht den Luxus hat, Umwege zu gehen.
BB: Glauben Sie, dass der Stellenwert von Kultur im Bewusstsein der Bevölkerung dank der Pandemie zugenommen hat?
MR: Darüber habe ich mir wenig Gedanken gemacht, dafür habe ich einen etwas zu holistischen Kulturbegriff. Ich habe mit meinen Töchtern natürlich zuhause getanzt, wir haben zuhause Bücher gelesen, wir haben uns Stücke angeguckt. Wir haben andere Dinge in unserem Leben gemacht, die wir vorher nicht gemacht haben, plötzlich wurde der private Raum wieder sehr reich. Viele Dinge, die ausgelagert waren, wurden sozusagen rückverlagert. Das ist gut und schlecht. Ich glaube, wenn man keine Familie hat oder keine engen Freunde, dann herrschte hier eine große Einsamkeit. Da wird zum Beispiel der Kinobesuch, der nicht mehr möglich ist, als großer Verlust wahrgenommen. Ich habe selbst vor allem die Entkoppelung der verschiedenen Vorgänge, also des Konsums, des Privatlebens, der öffentlichen Sphäre, die komplette Digitalisierung, sehr deutlich wahrgenommen. Wenn diese Verknüpfungen so schwach sind, so labil, und von dieser Pandemie so leicht aufgehoben werden können, dann muss man jetzt an Alternativen arbeiten, die wirklich lebenswert sind.
BB: Vielen Dank für Ihre Zeit, Milo Rau.
Interview: Thorsten Schröder
Über Milo Rau:
Milo Rau lässt sich schwer kategorisieren. Der Schweizer hat mehr als 50 Theaterstücke, Filme und Bücher veröffentlicht, wurde zweimal zum Berliner Theatertreffen eingeladen und zum Ehrendoktor der Universitäten Lund und Gent ernannt. Mit gerade mal 41 Jahren erhielt Milo Rau für sein Lebenswerk den Europäischen Theaterpreis. 2007 gründete er das IIPM – International Institute of Political Murder, seit der Spielzeit 2018/19 ist er künstlerischer Direktor des belgischen NTGent. In seinem neuen, mit dem Schweizer Filmpreis 2021 ausgezeichneten Film “Das Neue Evangelium” fragt er: Was würde Jesus zur heutigen Flüchtlingskrise sagen? In der Livestream-Diskussionsreihe “School of Resistance” diskutiert er mit Aktivisten und Künstlern über Kunst als transformative, realitätsschaffende Praxis.
Mehr Informationen zu Milo Rau gibt es hier.
(C) 09/05/2021
FIND more curated content on instagram: @bétonbleumagazine